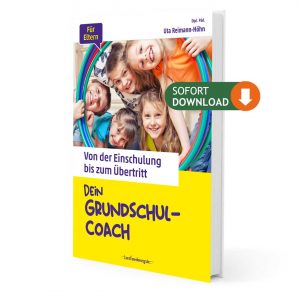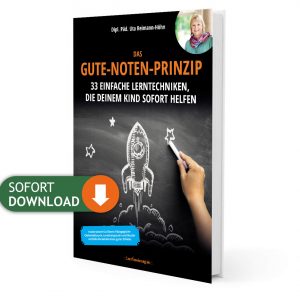Der erste Schultag in den 70er-Jahren – ein Erlebnis mit bleibendem Eindruck: du sitzt auf einem harten Holzstuhl, vor dir ein Heft mit karierten Linien und einem liebevoll aufgeklebten Namensschild. Die Lehrerin – meist im Kostüm, mit Dutt und ernster Miene – schreibt mit Kreide in schnörkeliger Schrift an die Tafel, während der Tafelschwamm in einem Eimer Wasser schwimmt und leise vor sich hin müffelt.

Die 1970er Jahre: Handwerk, Häkeldeckchen & Blockflöte
In den 70er‑Jahren war der Schulalltag praktisch und oft klar geschlechtlich aufgeteilt: Mädchen nähten, häkelten, kochten, Jungen sägten, hämmerten – alles meistens im Fach Handarbeit, Hauswirtschaft & Turnen.
Musikunterricht begann oft mit der Blockflöte und der dritten Klasse – begleitet von Triangel und vielleicht Schellenring oder Melodika. Und: Schwimmen zu lernen war Standard – das Seepferdchen war ein Muss. Manche Schulen hatten sogar kleine Hallenbäder – heute kaum denkbar, denn die finanziellen Mittel sind knapp.
Sportunterricht war noch stark bewegungsorientiert, bewegte sich also weit über reines Turnen hinaus – erste Ansätze der Theorieintegration entstanden.
War bei Papa alles anders?
Viele Eltern erinnern sich beim Blick auf die heutige Schule unweigerlich an ihre eigene Kindheit zurück: „Bei uns war das ganz anders!“ – und genau das beschreibt der Beitrag „Bei Papa war vieles anders“ auf lernfoerderung.de auf wunderbar anschauliche Weise. Ob Pausenhofspiele, Brötchen mit Mett oder der Umgang mit Fehlern im Diktat – der Schulalltag früher war nicht nur analoger, sondern auch direkter. Die Kinder von heute wachsen mit Tablets, Smartboards und individualisierten Lernplänen auf – was vieles flexibler macht, aber auch komplexer. Der Artikel zeigt eindrucksvoll, wie sich Werte, Methoden und Lernumgebungen im Wandel der Zeit verändert haben – und lädt ein, die eigene Schulzeit mit einem Augenzwinkern, aber auch kritisch zu betrachten.
Die 1980er und 1990er Jahre: Öffnung und technischer Aufbruch
In den 80ern setzte sich Koedukation weiter durch: Plötzlich nähte auch mal ein Junge – und im Werken durften Mädchen mitmachen. Trotzdem blieben Klassiker wie Häkeln, Sticken – meist im Schulunterricht, meist handwerklich.
Die 90er brachten die ersten schulischen PCs (Windows 95!) – Lerninhalte blieben überwiegend frontal, doch die technische Vision begann, das Klassenzimmer zu verändern. Hauswirtschaft wurde Wahlpflichtfach, Handarbeit und Werken verloren etwas an Bedeutung.
Die 2000er Jahre: Pisa‑Schock und Kompetenzorientierung
Der Pisa‑Schock ab 2001 veränderte Lehrpläne massiv: Kernkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen bekamen Priorität – praxisorientierte Fächer wie Werken oder Hauswirtschaft verschwanden oft aus dem Pflichtstundenplan oder wurden zusammengelegt, z. B. als AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales) oder HTW.
Schwimmunterricht – einst selbstverständlich – geriet zunehmend unter Druck: Viele Bäder waren marode, Lehrkräfte fehlten. Die Realität begann, ernstzunehmende Lücken entstehen zu lassen.
Die 2010er Jahre: Digitalisierung, Projektwochen – und das stillere Verschwinden des Praktischen
Mit dem „Digitalpakt Schule“ wurde das Klassenzimmer digital modernisiert: Tablets, einige WLAN-Zugänge – viele Schulen setzten noch stärker auf digitale Medien. Doch häufig blieb dafür weniger Zeit für Werkunterricht oder Musikprojekte. Werken und Hauswirtschaft wurden zum Projekt – punktueller, digitaler, gelegentlicher.
Blockflöte und Triangel wurden Fundstück – Musikunterricht vielfach ohne Instrumente.
2020–2025: Corona‑Einschnitt – und der Schwimmunterricht in der Krise
Die Corona-Pandemie war der Tiefpunkt für praktische Bildung: Homeschooling, geschlossene Hallenbäder, keine Schwimmstunden. Viele Kinder verließen die Schule ohne Schwimmfähigkeit. Laut DLRG stieg der Anteil der Nichtschwimmer von ca. 10 % (2017) auf 20 % (2022) – eine doppelte Zunahme.
2024 bot etwa jede fünfte Grundschule keinen Schwimmunterricht mehr an. In Baden‑Württemberg betraf das sogar über 20 % der Schulen, mehr als 492 betroffene Schulen – die Kultusministerin plant Fortbildungen und Alternativmodelle wie Blockunterricht oder Schwimmschullandheime.
Lösungen sprießen: In Kasendorf (Oberfranken) steht ab Frühjahr 2025 ein Schwimmcontainer vor der Grundschule – dort sollen bis zu 50 % der Kinder das Seepferdchen schaffen können DIE WELT. Der DLRG mahnt derweil langfristige Strategien an, denn Schwimmenlernen gehört zur Grundausbildung – wie Lesen, Schreiben, Rechnen.
Übersichtstabelle: Schulentwicklung von den 70ern bis heute
| Zeitraum | Hauswirtschaft & Handarbeit | Musikunterricht | Werken / Sachkunde | Schwimmunterricht |
|---|---|---|---|---|
| 1970er | Traditionelles HHT, klare Rollenteilung | Blockflöte, Triangel überall | Handwerklich-praktisch | Standard, verpflichtend |
| 1980er/90er | Koedukation, erste PCs, Wahlpflicht | Musik wird diverser | Theorie gewinnt leicht an Gewicht | Erste Schwächen durch Bädernotstand |
| 2000er | AES/HTW als Pflichtfach, weniger Praxis | Instrumente seltener, Fokus auf Theorie | Weniger Praxis, mehr Kompetenzorientierung | Rückgang, Probleme nehmen zu |
| 2010er | Projektorientiert, Digitales im Fokus | Musik ohne Instrumente, digitaler Zugang | Theorie dominiert, Werk praktisch rar | Fast nur noch projektweise vorhanden |
| 2020–2025 | Digitalunterstützung, kaum Handarbeit | Digital, manchmal virtuell | Wenig direkter Praxisbezug | Große Lücken, kreative Lösungen entstehen |
Und was bedeutete das alles für die Kinder von damals?
Für die SchülerInnen der 70er-, 80er- oder auch frühen 90er-Jahre war die Schule ein Ort der Ordnung – manchmal streng, oft wenig flexibel, aber auch verlässlich. Es gab kaum Individualförderung, kein Verständnis für „Lernstile“, keine psychologische Betreuung. Wer nicht mitkam, musste „sich mehr anstrengen“. Und wer auffiel, lernte früh, still zu sitzen.
Doch in all dieser Strenge lag auch Sicherheit. Die Rituale, das gemeinsame Musizieren – auch wenn es schief klang –, die Handarbeitsprojekte, der Stolz, einen Topflappen selbst gehäkelt oder ein Vogelhäuschen gebaut zu haben, schufen Erfahrungen, die viele von uns bis heute nicht vergessen haben. Schule war mehr als Wissensvermittlung: Sie war auch ein Ort des Tuns, ein Ort für erste Erfolgserlebnisse – mit der eigenen Hand geschaffen, nicht per Klick.
Für viele Kinder bedeutete diese Schule: klare Erwartungen, wenig Mitsprache, aber auch ein Gefühl von Zugehörigkeit und Sinn. Das erste Schwimmabzeichen, der Auftritt beim Klassenflötenkonzert, die genähte Einkaufstasche – sie waren Ausdruck davon, dass man etwas kann. Dass man wächst.
Natürlich war nicht alles besser. Vieles war normierend, überfordernd oder gar beschämend – und manches sollte nie zurückkehren. Aber es bleibt die Frage: Was davon war wirklich wertvoll? Und was fehlt heute?
Die Schule von morgen muss nicht wie die von gestern sein. Aber sie darf auch nicht vergessen, was Kindern gutgetan hat. Struktur, gemeinsames Tun, gelebte Praxis – das ist Bildung zum Anfassen. Und die brauchen Kinder – heute mehr denn je.
War Schule früher besser?
„Schule früher und heute“ – das ist keine Schmonzette, sondern eine Zeitreise mit Lachern und ernsten Echos. Früher war Schule oft greifbarer: Du nähmtest, sängst, sägest – warst präsent, praktisch, geerdet. Heute kannst du präsentieren, formatieren, klicken – aber das Leben an sich ist manchmal nur noch in Algorithmen digital erklärt, nicht mehr durch echte Erfahrungen geformt.
Kreativität, handwerkliche Fertigkeiten, musikalische Erfahrung – das alles zählt. Und Schwimmen sollte wie Lesen und Schreiben sein – wer das nicht kann, fehlt etwas Entscheidendes in seiner Bildung. Hoffen wir, dass Schule der Zukunft beides schafft: Digital und praktisch, vernetzt und lebensnah.